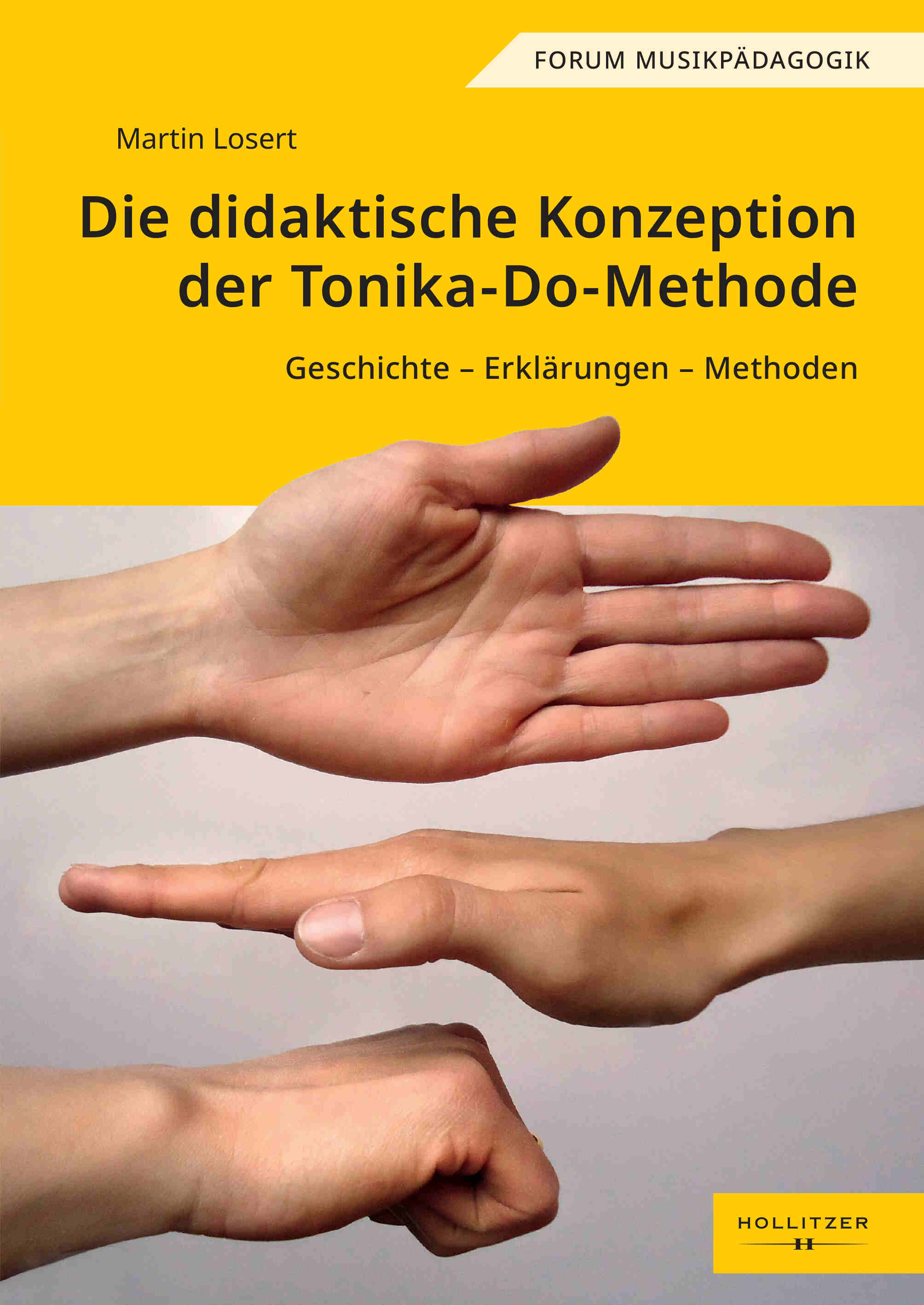
Martin Losert: Die didaktische Konzeption der Tonika-Do-Methode. Geschichte – Erklärungen – Methoden, Augsburg: Wißner Musikbuch Verlag, 2024 (Forum Musikpädagogik Band 95), 352 Seiten, 17 x 24 cm, Deutsch, Grafiken, Softcover
ISBN 978-3-99094-569-8 (pbk) € 45,00
Die didaktische Konzeption der Tonika-Do-Methode
Geschichte – Erklärungen – Methoden
Merkmale von Tonika-Do in Geschichte und Gegenwart —
historische Entwicklung und Methodik
Aus den ursprünglichen Ideen Guido von Arezzos erwuchs die mittelalterliche Solmisation. Spätere Fortentwicklungen waren die französische Ziffern- und die englische Tonic-Solfa-Methode, auf die die Tonika-Do-Methode unmittelbar zurückgeht. Ihre eigentliche Genese ist jedoch nicht zu trennen von sozialen und historischen Rahmenbedingungen, denen die maßgeblichen Protagonist*innen der Tonika-Do-Bewegung unterworfen waren.
Ein besonderes Charakteristikum sind die diversen Denk- und Übungsmittel wie Solmisationssilben, Handzeichen, Rhythmussprache und die verschiedenen relativen Notationsformen. Zusammen mit der fünfstufigen Lehrsystematik bilden sie den methodischen Kern der Konzeption von Tonika-Do und dienen der Ausprägung eines inneren musikalischen Gehörs. Der Vergleich mit anderen Ansätzen zeigt, dass Tonika-Do auch heute noch ein bereicherndes methodisches Repertoire bietet.
INHALT
Vorwort
Einleitung
1. Zielsetzung und Gliederung der Arbeit
2. Stand der Forschung
3. Quellenlage
4. Der Begriff der Methode
I Tonika-Do – eine Form relativer Solmisation
1. Elementare Musikalisierung
2. Das Prinzip der relativen Solmisation
3. Relative Solmisation als sprachähnliches Zeichensystem
4. Relative Solmisation im Spiegel lernpsychologischer Theorien
II Historische Solmisationskonzepte als Vorlage
der Tonika-Do-Methode
1. Guido von Arezzo
2. Hexachordlehre
3. Das Heptachord als strukturelle Grundlage von Solmisation
4. Die Ziffermethode nach Galin-Paris-Chevé
5. Die Tonic-Solfa-Methode
III Entstehung und Entwicklung der Tonika-Do-Methode
1. Von Tonic-Solfa zu Tonika-Do
2. Die Protagonisten
3. Der Tonika-Do-Bund
4. Der Methodenstreit
IV Denk- und Übungsmittel
1. Funktionen und Prinzipien der Denk- und Übungsmittel
2. Tonika-Do Silben
3. Silbenschrift und Rhythmusnotation
4. Punktnotation
5. Relative Liniennotation
6. Elfliniennotation
7. Tonika-Do-Farben und Spiele
8. Rhythmussprache
9. Handzeichen
10. Silbentafeln, Linientafeln und Wandernote
11. Abfolge der Denk- und Übungsmittel
V Die Systematik der Tonika-Do-Methode
1. Systematik als methodisches Kernelement
2. Die ältere Form der fünfstufigen Systematik
3. Die neuere Systematik
4. Formen der Lehrsystematik im Tonika-Do-Instrumentalunterricht
VI Die Tonika-Do-Unterrichtsliteratur
1. Merkmale spezieller Sammlungen von Tonika-Do-Unterrichtsliteratur
2. Sammlungen von Tonika-Do-Unterrichtsliteratur
VII Lehr- und Lernziele der Tonika-Do-Methode
1. Zielbereiche
2. Leitziele
3. Richtziele
4. Grobziele
VIII Tonika-Do im Vergleich mit anderen musikpädagogischen
Konzeptionen des 20. Jahrhunderts
1. Tonika-Do im Vergleich
2. Die Méthode Jaques-Dalcroze
3. Das Orff-Schulwerk
4. Die Suzuki-Methode
5. Die Yamaha-Methode
6. Die Kodály-Methode
7. Die Jale-Methode
8. Die Music Learning Theory von Edwin E. Gordon
IX Schlussbemerkungen
1. Zusammenfassung
2. Ausblick
Anhang
1. Tabellen und Dokumente
2. Verzeichnisse




