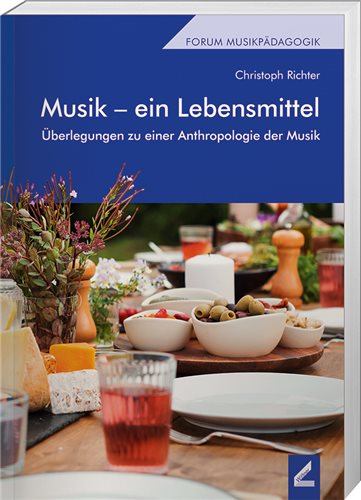
Christoph Richter: Musik – ein Lebensmittel. Überlegungen zu einer Anthropologie der Musik, Augsburg: Wißner Musikbuch Verlag, 2019 (Forum Musikpädagogik Band 149, Berliner Schriften), 160 Seiten, 17 x 24 cm, Deutsch, Abbildungen und Notenbeispiele, Softcover
ISBN 978-3-99094-498-1 (pbk) € 24,80
Musik – ein Lebensmittel
Überlegungen zu einer Anthropologie der Musik
Der Plan zu dem Versuch, etwas so Anspruchsvolles wie eine Anthropologie des Umgangs mit Musik zu schreiben, entstand aus der Unsicherheit eines bekennenden Musikpädagogen gegenüber der Aufgabe, Grundlagen und Anregungen für den Umgang mit Musik zu bieten – für Schüler*innen, Studierende, erwachsene Laien, bisweilen auch für praktizierende Musiker*innen. Was Pädagogik nach Meinung vieler Pädagog*innen erreichen sollte, scheint immer weniger für diese Kundschaft gedacht und praktiziert – und viel zu sehr und zu eng auf Musiklehre, Musikgeschichte, auf Musizierversuche und auf ein amtlich-didaktisch definiertes, fachlich-zielorientiertes Lernen eingeschränkt.
Immer deutlicher wurde, dass Hilfe und Anregung zum vielseitigen, persönlichen Umgang der Menschen mit Musik auf einem viel weiteren Feld angesiedelt sein müsse: auf einem Feld ohne (Fach-)Grenzen.
Versuch einer Beschreibung und Deutung der Art und Weise, wie Menschen ihr Leben auch mit Musik verbringen und gestalten können.
Informationen zur Reihe Forum Musikpädagogik
INHALT
1 Im Stimmzimmer
2 Ouvertüre – Was ist Musik?
MUSIK – hören, spielen, erfinden, ergründen
(geschichtlich und theoretisch), und auch lesen?
3 Allegro moderato – Was ist Kultur?
Definitionen
Die erste Geschichte
Die zweite Geschichte
Exkurs zur Positionalität des Menschen
bei Helmut Plessner
Wie in der Kunst die besondere Positionalität des Menschen gestaltet wird
Alltagskultur und Hochkultur
Kultur und Bildung
Kulturtheorien
4 Lento (Überleitung) –
Vorüberlegungen für das Nachdenken über eine Musikkultur
Musik als Kulturphänomen
Das private, gemeinschaftliche und offizielle Kulturleben
Entstehung – Aufbau – Pflege – Vielfalt
der individuellen Musikkultur oder des Lebens mit Musik
Die Beschäftigung mit Musik in der Spannung
von Ich- und Es-Wahrnehmung (nach Gernot Böhme)
5 Intermezzo – Kopräsenz von Ich- und Es-Wahrnehmung
6 Variationen – Der Anteil der Musik am Kulturleben des Menschen
Musik im Netz kultureller, anthropologischer, sozialer Kontexte
Überlegungen zur Kultur des Geschichtsbewusstseins gezeigt an Beispielen der Musik
Beispiel 1: Der Choral
»Nun komm, der Heiden Heiland« (»Veni redemptor Gentium«) –
seine Geschichte und was ich mit ihr vielleicht zu tun habe
Beispiel 2: Leonard Bernstein,
»Mass. A Theatre Piece for Singers, Players und Dancers«
Der kleine oder größere Grenzverkehr zwischen U und E
Der Weg der Musikkultur von der Volks- und Gebrauchskunst zur Hochkunst
Musik als eine Kunst
7 Rondo – Teilkulturen der Musik
Überlegungen zur Kultur des Musikhörens
Vorüberlegung:
Die Grenzen sprachlicher und gedanklicher Erkenntnis
Zusammenfassung: Was ist es, das sich beim Hören ereignet?
Konkrete Anregungen zum Hören von Musik – Hörweise I
Hörweise II
Beispiel a) – Ein Volksfest
Beispiel b) – Wohnungsfragen
Beispiel c) – Kompositionsunterricht
Überlegungen zur Kultur des Singens
Beispiele
Das Singen Einzelner in religiösen Zusammenhängen
Vier- oder mehrstimmige homophone Choräle und Lieder
Motiv- und Themenspiele der Stimme und des Singens
Singende Klangbänder, klingendes Licht
Singen im Musiktheater
Singen als seelischer Ausdruck
Überlegungen zur Kultur des Musizierens
Kulturelle Identität, gezeigt an Bewegung zu Musik
Gegensätzliche Möglichkeiten 1
Gegensätzliche Möglichkeiten 2
8 Finale – Beispiele des Konzert- und Musiklebens, vers tanden als Aspekte der Geschichte und Anthropologie der Musikkultur
Der lebensweltliche, gesellschaftliche und kulturelle Kontext der Musik, gezeigt an der Sinfonie
Von den Einleitungssignalen zu ausführlicheren Sinfonie-Einleitungen
Der Weg zum öffentlichen, bürgerlichen, kommerziellen Konzertbetrieb
Der Spielcharakter der Sinfonie
Typ I – Die Sinfonie als Botschaft und Bekenntnis
Typ II – Die Sinfonie als Schicksalsdrama
Typ III – Die Sinfonie als programmatische Musik
Die Sinfonie als autobiographische Schilderung
Die Nationalsinfonie
Zusammenfassung: Die Sinfonie und die Sinfoniekonzerte als kulturelle und gesellschaftliche Ereignisse
Die Sinfonie als Raum-Musik – Konzertsäle
Zur Kultur des Sinfoniekonzerts
Literatur für den Abschnitt »Zur Kultur des Sinfoniekonzerts«
Blicke von der Musik hinaus ins Leben – Das Fachübergreifende
Musik zur Unterhaltung – Unterhaltungsmusik zum Beispiel: Jazz und Schlager
9 Coda – Die Kultur des Streichquartetts
Das Musizieren im Streichquartett –
einige persönliche und allgemeine Vorbemerkungen –
Musik als symbolische Kommunikation
Einige Überlegungen zum Besonderen des Streichquartetts
Das Musizieren im Streichquartett – eher aus der Sicht des Publikums betrachtet
Das Musizieren im Streichquartett – eher aus der Sicht der Musizierenden
Notabene
»A Quattro« – Die Bedeutung der Zahl Vier
als Grundlage der Streichquartettmusik
1) Der mystisch-symbolische Aspekt
2) Der klangliche Aspekt
3) Der musiktheoretische Aspekt
4) Der sozi ale Aspekt
5) Der pädagogische Aspekt
Einige Bemerkungen zur Geschichte des Streichquartetts
Joseph Haydn, der Quartettvater und -meister
Das Streichquartett im Musik- und Kulturleben
Stimmen – Einspielen – Kennenlernen: Überlegungen vorwiegend für Laien
Ein Plädoyer für Begleitungen
10 Ein Beispiel zum Schluss – Dimitri Schostakowitschs
Streichquartett Nr. 8, der erste Satz (geschrieben 1960)
11 Materialien
Anmerkungen zum Quartettspiel von Theodor W. Adorno
Musizieren im Streichquartett – Abbildungen

