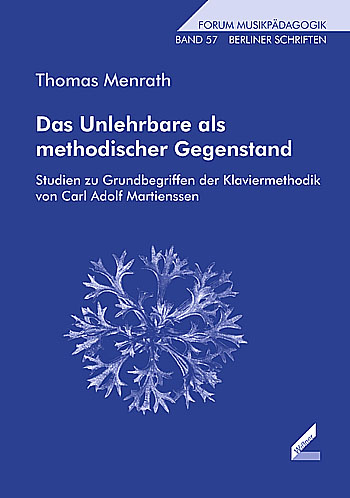
Thomas Menrath: Das Unlehrbare als methodischer Gegenstand. Studien zu Grundbegriffen der Klaviermethodik von Carl Adolf Martienssen, Augsburg: Wißner Musikbuch Verlag, 2003 (Forum Musikpädagogik Band 57, Berliner Schriften), 137 Seiten, 17 x 24 cm, Deutsch, Softcover
ISBN 978-3-99094-316-8 (pbk) € 22,00
Das Unlehrbare als methodischer Gegenstand
Studien zu Grundbegriffen der Klaviermethodik von Carl Adolf Martienssen
Bis heute gehört die Klaviermethodik von Carl Adolf Martienssen (1881–1955) zu den Grundlagenwerken einer Lehre des Klavierspiels und des Klavierunterrichts. Das als „unlehrbar“ (Edwin Fischer) aufgefasste Zusammenspiel von Intellekt und Intuition wird bei Martienssen zum zentralen methodischen Gegenstand. In neuerer Zeit wird seine Methodik gelegentlich als irrational kritisiert oder als politisch belastet vehement abgelehnt. In dieser interdisziplinären Arbeit zeigt der Autor Thomas Menrath, worin das Irrationale in der Lehre Martienssens tatsächlich besteht und wie sich dies in der Klaviermethodik bis in die Gegenwart auswirkt. Zugleich entwirft der Autor eine zeitgeschichtliche Skizze, die die Entstehung des Werkes im Kontext der krisenhaften Atmosphäre im Deutschland der zwanziger und frühen dreißiger Jahre nachvollziehbar macht.
Informationen zur Reihe Forum Musikpädagogik
CONTENTS
Vorwort
Einführung in den Gegenstand
1. Bedeutung der zwanziger und dreißiger Jahre für die Klaviermethodik
2. Entstehungszusammenhang der psychologisch orientierten Methodik
3. Eingrenzung des Gegenstands und der Zielsetzung der Arbeit
Methodologische Grundlegung
1. Klavierspiel. Unterschiedliche Aspekte des Klavierspiels und gedankliche Struktur ihres methodischen Zugangs
2. Klavierunterricht. Grenzen des Lehrbaren als Streitfrage der Klaviermethodik
3. Klaviermethodik. Versuch einer wissenschaftstheoretischen Einordnung
Zu Person und Werk C. A. Martienssens
1. Biographische Anmerkungen
2. Rezeption der Methodik
2.1 Rezeptionsgeschichte
2.2 Schwierigkeiten der Rezeption
3. Abriß der Lehre als Ganzes
3.1 Methodischer Ausgangspunkt
3.2 Grundbegriffe
4. Ideologie
„Wunderkindkomplex“
1. Darstellung
2. Analyse
2.1 Methodische Einordnung des Begriffs
2.2 Die Analogie zum Spracherwerb
2.2.1 Der neurophysiologische Aspekt
2.2.2 Der psycholinguistische Aspekt
2.2.3 Der musikästhetische Aspekt
3. Die Relevanz des Komplexmodells für die Klaviermethodik
3.1 Die Problematik der Selbstregulierung
3.2.1 Der Anfangsunterricht nach Martienssen
3.2.2 Kritik des Konzeptes
4. Ergebnisse und deren Übertragung auf die Klaviermethodik
4.1 Ablehnung des Komplexes als Erklärungsmodell
4.2 Methodenvergleich. Der Anfangsunterricht nach Varró
4.2.1 Darstellung
4.2.2 Auswertung
4.3 Zusammenfassung
„Schöpferischer Klangwille“
1. Darstellung
2. Analyse
2.1 Methodische Einordnung des Begriffs hinsichtlich des ersten Grundbegriffs
2.2 Der musikästhetische Aspekt. „Gestaltwille“
2.3 Ethik und Ästhetik. „Gestaltungswille“
2.4 Der geistesgeschichtliche Aspekt. „Irrationalität“
2.4.1 Die Stellung des Irrationalen im methodischen System
2.4.2 Versuch einer Eingrenzung des Begriffs des „Irrationalen“
2.4.3 Irrationalismus der zwanziger Jahre
2.4.4 Exkurs: Flesch und Martienssen
3. Relevanz des Modells für die Klaviermethodik
3.1 Der methodische Aspekt. ‚Verstehen‘ und ‚Erleben‘ im Werkstudium. Methodenvergleich
3.1.1 Gát
3.1.2 Neuhaus
3.1.3 Varró
3.1.3.1 Darstellung
3.1.3.2 Auswertung
3.1.4 Martienssen
3.1.4.1 Positive Substanz der Methode
3.1.4.2 „Irrationalität“ als methodisches Hindernis
4. Schlussfolgerungen
4.1 Das Scheitern des Anspruchs der Methode als „Synthese“
4.2 Der ‚Widerstand‘ gegen das Bewußtsein und seine Aufhebung in der künstlerischen Arbeit
Martienssen, Wundt und Driesch
1. Einführung in die Fragestellung und Zielsetzung der Untersuchung
2. Der „psychologische Gegenstand“ in der Psychologie Wilhelm Wundts
2.1 Der Gegenstandsbereich der Psychologie nach Wundt
2.2 Der hypothetische Seelenbegriff als „transcendente Idee“
2.3 Die Bedeutung des Willens in der Psychologie Wundts
2.4 Psychische Gesetzmäßigkeiten
2.5 Methoden der Psychologie Wundts
2.6 Zusammenfassung. Der zulässige Anwendungsbereich der Psychologie Wundts
3. „Willenserlebnis“ und „Entelechie“ in der vitalistischen Lehre Hans Drieschs
3.1 Der empirische Ausgangspunkt Drieschs
3.2 Der Begriff der „Entelechie“
3.3 Psychologische Anteile der Lehre
3.3.1 Bewußtsein
3.3.2 „Willenserlebnis“
3.4 Die Beurteilung der Theorien Drieschs durch die zeitgenössische Wissenschaft
4. Psychologische Bezüge in der Methodik Martienssens
4.1 Martienssen und Wundt
4.2 Martienssen und Driesch
4.2.1 „Entelechie“ und „Gestaltwille“
4.2.2 „Willenserlebnis“ und „schöpferischer Klangwille“
Literaturverzeichnis
Abstract

