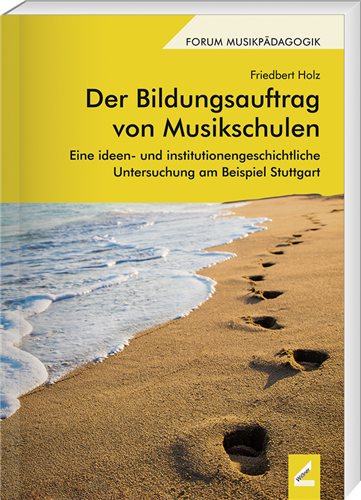
Friedbert Holz: Der Bildungsauftrag von Musikschulen. Eine ideen- und institutionengeschichtliche Untersuchung am Beispiel Stuttgart, Augsburg: Wißner Musikbuch Verlag, 2018 (Forum Musikpädagogik Band 140, Augsburger Schriften), 530 Seiten, 17 x 24 cm, Deutsch, Softcover
ISBN 978-3-99094-478-3(pbk) € 44,80
Der Bildungsauftrag von Musikschulen
Eine ideen- und institutionengeschichtliche Untersuchung am Beispiel Stuttgart
»Bildung ist das, was zurückbleibt, wenn das Gelernte wieder vergessen ist.« (Georg Kerschensteiner)
Der Verband deutscher Musikschulen bekennt sich in seinem Grundsatzprogramm Musikalische Bildung in Deutschland. Ermöglichen – Gewährleisten – Sichern! (2016) zu einem humanistischen Welt- und Menschenbild. Doch was genau verbindet den Bildungsauftrag der 930 öffentlichen Musikschulen in Deutschland mit Bildungsideen, die an der Wende zum 19. Jahrhundert entstanden sind?
Diese Untersuchung versteht sich als Beitrag zur Bildungsdiskussion um die Institution Musikschule. Untersucht werden die Wirkungen humanistischer Bildungstheorien auf die Musikschulentwicklung im 19. Jahrhundert sowie in der Gegenwart. Am Beispiel der Stuttgarter Musikschule und ihrer Entwicklungsgeschichte wird gezeigt, wie sich das Verständnis von musikalischer Bildung in der Musikschulpraxis gewandelt hat – von den Anfängen einer institutionalisierten Musikerziehung bis hin zu dem Selbstverständnis der Musikschule als »inklusive« Bildungseinrichtung.
Die Stuttgarter Musikschule ist heute in der Breiten-, Spitzen- und Sonderförderung gleichermaßen erfolgreich. Somit richtet sich der Blick auf die Voraussetzungen, unter denen Musikschulen einen historisch gewachsenen Bildungsauftrag erfüllen können.
Spannende und beachtenswerte Erkenntnisse zur gesellschaftlichen Bedeutung unserer Musikschulen.
CONTENTS
Vorbemerkung
Einleitung
Teil I: 19. Jahrhundert
1. Bürgerliches Musikleben
1.1 Historische Skizze: Württemberg und Stuttgart
1.2 Die bürgerliche Gesellschaft formiert sich
1.3 Bildung als gesellschaftstreibende Kraft
1.3.1 Zur Entwicklung des Bildungsbegriffs
1.3.2 Bildung in öffentlichen Lebensbereichen
1.3.3 Das allgemeinbildende Schulwesen unter dem Einfluss der Reformen Wilhelm von Humboldts
1.3.4 Bildung in der Familie
1.4 Hinwendung zur Musik
1.4.1 Musik in der bürgerlichen Gesellschaft
1.4.2 Kultur als Medium von Bildung
1.4.3 Der Kunstbegriff in Friedrich Schillers Briefen „Über die ästhetische Erziehung des Menschen“
1.4.4 Musikästhetische Positionen
1.4.5 Soziologische Aspekte
1.5 Musikleben in Stuttgart
2. Begründung einer institutionalisierten Musikerziehung
2.1 Status quo der musikalischen Bildung
2.1.1 Die Berufsausbildung ausübender Musiker zu Beginn des 19. Jahrhunderts
2.1.2 Singunterricht an allgemeinbildenden Schulen
2.1.3 Privatmusikerziehung
2.2 Erste Realisierungsversuche einer institutionalisierten Musikerziehung in Stuttgart
2.2.1 Hohe Carlsschule
2.2.2 Der Plan Karl Kastners zur Errichtung einer allgemeinen Kunstanstalt
2.2.3 Das Musikinstitut im Waisenhaus
2.2.4 Eine Musikschulgründung nach dem System Logier
2.2.5 Stuttgarter Musikschule / Konservatorium Stuttgart
3. Institutionalisierte Musikerziehung im Kontext humanistischer Bildung
3.1 Zwei Richtungen der Musikpädagogik
3.1.1 Musikpädagogik im 19. Jahrhundert
3.1.2 Die akademisch-fachmäßige Richtung
3.1.3 Die humanistische Richtung
3.2 Von der humanistischen zur musikalischen Bildung – Adolph Bernhard Marx und seine Kunstlehre
3.2.1 Marx’ Beitrag zur Entwicklung eines neuzeitlichen musikalischen Bildungsbegriffes
3.2.2 Musikalische Bildung in ihrer gesellschaftlichen und persönlichkeitsbildenden Dimension
3.2.3 Folgerungen für die musikalische Lehre
3.2.4 Vorzüge der institutionellen Musikerziehung
3.2.5 Zur Kooperation von Musik und Pädagogik (Sigrid Abel-Struth)
3.3 Die Entwicklung der Musikpädagogik an den Stuttgarter Musikinstituten in Abhängigkeit von Bildungsaufgaben und Trägerschaft derselben
3.3.1 Im Widerschein absolutistischer Herrschaftsform
3.3.2 Von pädagogischen Ambitionen und Musikschulen als Geschäftsmodell
3.3.3 Dilettanten und Kunstschüler gehen getrennte Wege – Kritik der Konservatoriumsbildung
3.3.4 Forderung nach einem „maßgebenden Concentrationspunkt musikpädagogischen Wirkens unter Staatsschutz“ (Ina Loehner)
Teil II: Gegenwart
4. Das kritische Potential humanistischer Bildungsideen für die Musikschularbeit
4.1 Die Bildungstheorien Humboldts und Schillers im Spannungsfeld von Ideal und Wirklichkeit
4.1.1 Der humanistische Bildungsgedanke in seinem zeitlichen Bezug
4.1.2 Bildung und personale Identität: der Bildungsprozess in Humboldts „Theorie der Bildung des Menschen“
4.1.3 Freiheit und Gebundenheit – Ganzheit und Mannigfaltigkeit
4.1.4 Kunst als Therapie gegen die Entfremdung des Menschen von seiner Natur (Schiller)
4.1.5 Das Humboldtsche Bildungsideal „vor dem Hintergrund eines neoliberalen Gesellschaftssystems“ (Bernhard Heinzlmaier)
4.1.6 Zum Verhältnis von Kunst und Moralität in Schillers Briefen über die ästhetische Erziehung des Menschen
4.2 Von dem, was musikalische Bildung in Anlehnung an Humboldt und Schiller sein könnte
4.2.1 Humboldts Sprachtheorie als Schlüssel zur musikalischen Bildung
4.2.2 (Musikalisches) Spiel als Grundlage einer Lebenskunst (Jeremy Rifkin)
4.2.3 Schillers Begriff der „aktiven Bestimmbarkeit“: Bezüge zum musikalischen Lernen
4.2.4 Dimensionen ästhetischer Erziehung und Bildung: Anspruch an die Musikschularbeit
5. Die Stuttgarter Musikschule und ihr Leitbild
5.1 Die Musikschule als kommunale Bildungseinrichtung
5.1.1 Der Weg der Stuttgarter Musikschule durch das 20. Jahrhundert
5.1.2 Die Stellung der Musikschule im Bildungswesen
5.1.3 Die Stuttgarter Musikschule im Überblick
5.2 Lehren und Lernen
5.2.1 Musikalische Kompetenzen vermitteln
5.2.2 Musik entdecken – Musik erleben
5.2.3 Musik und Schlüsselkompetenzen
5.3 Partnerschaft und Entwicklung
5.3.1 Die Musikschule als Bildungspartner
5.3.2 Die „lernende“ Musikschule
6. Der humanistische Bildungsgedanke – uneingelöstes Versprechen oder ideelles Fundament der Musikschularbeit?
6.1 Musikalische Bildung und humanistisches Erbe – Zwei Ansichten
6.1.1 „… denn ursprünglich Gemeintes lässt sich nicht einfach eliminieren“ – Auf der Suche nach einer musikalischen Bildungsidee (Karl Heinrich Ehrenforth)
6.1.2 „Abschied nehmen vom schönen Klang …“ – Aufbruch zur transhumanistischen Bildung (Norbert Schläbitz)
6.2 Die Musikschule und ihr Selbstverständnis als Bildungseinrichtung
6.2.1 Musikschule anders denken (Reinhart von Gutzeit, Andreas Doerne)
6.2.2 Inklusion an Musikschulen
6.3 Musikpädagogik zwischen Kontinuität und Wandel – „Zu den drei grundlegenden Arbeitsfeldern der Musikschule“ (Peter Röbke)
6.3.1 Arbeitsfeld 1: „Gestaltung musikalischer Lernund Lebenswelten – generationenübergreifend und in einer lebenslangen Perspektive“
6.3.2 Arbeitsfeld 2: „Erfahrung elementaren Musizierens und Vermittlung musikalischer sowie instrumentaler und vokaler Basiskompetenzen für alle Kinder“
6.3.3 Arbeitsfeld 3: „Förderung des professionellen Nachwuchses in musikalischen Berufen“
6.4 Ausblick: Bildungspolitische Perspektiven
6.4.1 Erwartungen an die Politik
6.4.2 Erwartungen an Musikschulen
6.4.3 Musikschulförderung in Sachsen-Anhalt
Zusammenfassung
Literaturverzeichnis
Weitere Quellen




