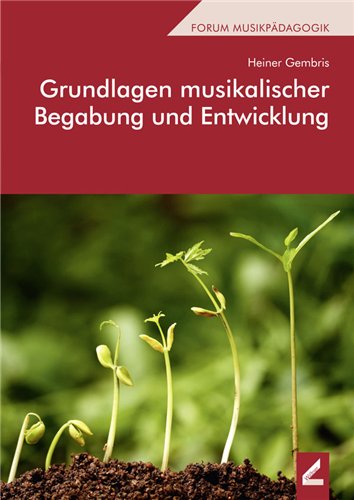
Heiner Gembris: Grundlagen musikalischer Begabung und Entwicklung, Augsburg: Wißner Musikbuch Verlag, 2017, (Forum Musikpädagogik Band 20, Wißner-Lehrbuch, Band 1), 476 Seiten, 14,5 x 21 cm, Deutsch, Abbildungen, Softcover
ISBN 978-3-99094-474-5 (pbk) € 44,80
Grundlagen musikalischer Begabung und Entwicklung
Das hochgelobte und längst zum Standardwerk avancierte Buch gibt einen umfassenden Überblick über das gesamte Gebiet der musikalischen Begabungs- und Entwicklungsforschung. Dabei wird nicht nur auf die Berücksichtigung der jüngeren Forschungsergebnisse Wert gelegt, sondern auch auf die Bezüge zu Musikkultur und Musikpädagogik. Als verständlich geschriebenes und übersichtlich aufgebautes Lehrbuch soll es zu musikalischer Begabung und Entwicklung zuverlässig Auskunft und Orientierung geben. Der Adressatenkreis umfasst Musikpädagogen, Musikwissenschaftler, Pädagogen, Musiker, Psychologen, Musiktherapeuten und musikinteressierte Laien.
Informationen zur Reihe Forum Musikpädagogik
CONTENTS
Vorwort zur ersten Auflage
Vorwort zur zweiten Auflage
1 Einleitung oder: Warum ist die Beschäftigung mit dem Phänomen Musikalität wichtig?
2 Themen und Fragestellungen der musikalischen Begabungsforschung
2.1 Alltagstheorien über Musikalität
2.2 Musikpädagogische Schriften als Quellen der Musikalitätsforschung
2.3 Musikalische Praxis und Musikalitätsforschung
3 Geschichte der musikalischen Begabungsforschung
3.1 Anfänge der Musikalitätsforschung
3.2 Anfänge der (musikalischen) Entwicklungspsychologie
3.3 Die Suche nach dem »Ur-Motiv« und den Ursprüngen der Musik in der Kindheit
3.4 Zur gegenwärtigen Situation der musikalischen Entwicklungspsychologie
4 Entwicklungspsychologie und musikalische Entwicklung
4.1 Entwicklungsbegriff
4.2 Begriff der musikalischen Entwicklung
4.3 Gegenstand und Aufgabe der Entwicklungspsychologie musikalischer Fähigkeiten
4.4 Forschungsmethoden
5 Was ist Musikalität und musikalische Begabung?
5.1 Der Terminus Musikalität und sein begriffliches Umfeld
5.2 »Musikalisch sein« – Definitionen in Schriften des 19. Jahrhunderts
5.3 »Wer ist musikalisch?« – Die Theorie Theodor Billroths
5.4 Neuere Definitionen der Musikalität
6 Kultur, historischer Wandel und Musikalität
6.1 Musik im historischen Wandel: Implikationen für den Musikalitätsbegriff
6.2 Kulturabhängigkeit des Musikalitätsbegriffes
6.3 Kulturübergreifende Universalien musikalischer Fähigkeiten
6.4 »Man müßte Klavierspielen können!« oder: Warum sind wir musikalisch?
7 Testen und Messen der Musikalität
7.1 Hypothetische Struktur und statistische Verteilung der Musikalität
7.2 Musikalitätstests
7.3 Was ist ein Test?
7.4 Aufgaben von Musikalitätstests
7.5 Die »Seashore Measures of Musical Talents«
7.6 Die »Measures of Musical Abilities« von Arnold Bentley
7.7 »Measures of Music Audiation« – die Musikalitätstests von Edwin Gordon
7.8 Kritik an Musikalitätstests
7.9 Künftige Perspektiven
8 Musikalität und Persönlichkeit
8.1 Musikalität und Intelligenz
8.2 Musikalität und andere Persönlichkeitsmerkmale
8.3 Musikalität, räumliche Begabung und Androgynie
8.4 Musikalität, Lateralisation und Händigkeit
8.5 Musikalität und absolutes Gehör
8.6 Wunderkinder
9 Erklärungsmodelle musikalischer Leistungen
9.1 Begabungskonzepte
9.2 Übung statt Begabung: das Expertisemodell
9.3 Qualität und Effektivität des Übens
9.4 Übung und musikalischer Ausdruck
9.5 Kritische Wertung des Expertisemodells
10 Determinanten von Begabung und Entwicklung
10.1 Wird Musikalität vererbt? Stammbaum-Untersuchungen und Zwillingsstudien
10.2 Sind Frauen musikalisch weniger begabt?
10.3 Anlage-Umwelt-Beziehungen
10.4 Sozialisation
10.5 Elternhaus und Medien
10.6 Sozioökonomische Faktoren
10.7 Familiäre Förderung
10.8 Die Rolle von Lehrern
10.9 Aktive Gestaltung der eigenen musikalischen Entwicklung
10.10 Die Bedeutung des Übens
10.11 Autodidaktisches Lernen
10.12 Zufälle, Schlüsselerlebnisse und kritische Lebensereignisse
11 Generationsspezifische und zeitgeschichtliche Einflüsse auf musikalische Biographien
11.1 Biographische Studien zu zeit- und generationsspezifischen Einflüssen auf die musikalische Entwicklung
11.2 Jugendmusik- und Singbewegung
11.3 Nationalsozialismus und Zweiter Weltkrieg
11.4 Rock’n’ Roll und Popmusik
11.5 Methodische Probleme bei der Erforschung generationsspezifischer Entwicklungsbedingungen
12 Musikalische Fähigkeiten und Behinderungen
12.1 Beeinträchtigungen der musikalischen Entwicklung durch Behinderungen
12.2 Geistige Behinderung
12.3 Hörschädigungen
12.4 Sehbehinderung
12.5 Amusie
13 Entwicklungstheorien und empirische Befunde
13.1 Die Entwicklungstheorie Piagets und ihr Einfluß auf die musikalische Entwicklungsforschung
13.2 Neuere Theorien der musikalischen Entwicklung
13.3 Der Symbolsystem-Ansatz
13.4 Graphische Repräsentation von Musik
13.5 Entwicklung bereichsspezifischer und bereichsübergreifender Kompetenzen
13.6 Das Spiral-Modell der musikalischen Entwicklung
13.7 Der kognitiv-wahrnehmungstheoretische Ansatz von M. L. Serafine
13.8 Die Theorie musikalischer Begabung und Entwicklung von E. Gordon
14 Wahrnehmungsfähigkeiten und musikalisches Lernen
14.1 Pränatale Wahrnehmungsfähigkeiten
14.2 Wahrnehmungsfähigkeiten im ersten Lebensjahr
14.3 Musikalische Wahrnehmung bis zum zehnten Lebensjahr
14.4 Rhythmische Fähigkeiten
14.5 Harmonik und Tonalität
14.6 Begriffliche Konzepte
14.7 Musikalisches Erleben und Ausdrucksverständnis
14.8 Transfereffekte musikalischen Lernens
15 Entwicklung des Singens
15.1 Bedeutung des Singens
15.2 Von frühkindlichen Vokalisationen zum ersten Lied
15.3 Phasen beim Erlernen eines Liedes
15.4 Die kognitive Theorie des Liederwerbs von Davidson
15.5 Entwicklung des Singens im Vorschulalter
15.6 Konturschemata als Beschreibungseinheit sich entwickelnder Singfähigkeiten
15.7 Die Konstruktion erster Umrisse des tonalen Raums
15.8 Entwicklung des Singens im Schulalter
15.9 Kritische Würdigung der Entwicklungstheorie des Singens
15.10 Entwicklung der Singstimme und des Stimmumfanges
16 Musikalisches Erleben und Präferenzen in verschiedenen Lebensaltern
16.1 Präferenzen und Erleben in der Kindheit
16.2 Musikerleben und Bewegung
16.3 Jugendalter und Pubertät
16.4 Exkurs: Alterseffekte, Generationseffekte und zeitgeschichtliche Aspekte musikalischer Präferenzen
16.5 Kontinuität und Wandel musikalischer Präferenzen und Urteile in der Lebenszeitperspektive
16.6 Musikalische Toleranz
16.7 Alter, Lebenssituation und Funktionswandel des Musikhörens
16.8 Präferenzen in höherem Alter
16.9 Lautstärke- und Tempopräferenzen
16.10 Musik und emotionales Erleben in höherem Alter
17 Allgemeine Aspekte musikalischer Entwicklung im Erwachsenenalter
17.1 Interindividuelle Unterschiede in musikalischen Werdegängen
17.2 Psychologische und physiologische Veränderungen
17.3 Kognitive Funktionen
18 Entwicklung kompositorischer Kreativität
18.1 Kreative Produktivität in der Lebenszeitperspektive
18.2 Quantität und Qualität: Werkstatistiken und ihre Probleme
18.3 Kompositorische Leistungen in verschiedenen Lebensaltern: Empirische Ergebnisse
18.4 Frühe und späte Kompositionen
18.5 Zusammenfassende Bewertung
19 Entwicklungsverläufe von professionellen Instrumentalisten
19.1 Entwicklungsphasen
19.2 Instrumentale Leistungen in höherem Alter: Möglichkeiten und Grenzen
19.3 Musizieren nach der Pensionierung
20 Musikalische Entwicklung im Erwachsenenalter: Musikamateure und musikalische Laien
20.1 »Was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmermehr«? Musikalische (Lern-)Fähigkeiten von Erwachsenen und Älteren
20.2 Musikalisches Langzeit- und Kurzzeitgedächtnis
20.3 Instrumentales Lernen bei erwachsenen und älteren Laien
20.4 Musikalisches Lernen, Selbsteinschätzung und Lernbedürfnis
20.5 Musiktherapeutische Studien mit älteren Patienten
21 Ausblick: Künftige Perspektiven musikalischer Entwicklungsforschung
Literatur
Sachregister
Personenregister




