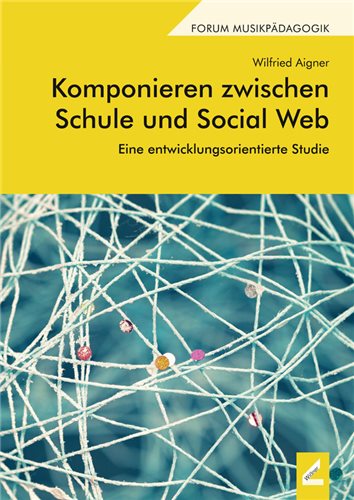
Wilfried Aigner: Komponieren zwischen Schule und Social Web. Eine entwicklungsorientierte Studie, Augsburg: Wißner Musikbuch Verlag, 2017 (Forum Musikpädagogik Band 144, Augsburger Schriften), 372 Seiten, 17 x 24 cm, Deutsch, Softcover
ISBN 978-3-99094-484-4 (pbk) € 39,80
Komponieren zwischen Schule und Social Web
Eine entwicklungsorientierte Studie
Die Entwicklung seit der Jahrtausendwende zeigt, dass insbesondere in der deutschsprachigen schulischen Musikpädagogik sowohl kompositorische als auch technologienutzende Tätigkeiten von Schüler(inne)n nach wie vor ein Randthema darstellen. Dem Komponieren im Sinne selbsttätiger Kompositionsaktivität von Kindern und Jugendlichen begegnet man eher sporadisch, und Internet- und Technologienutzung beschränkt sich meist auf das Abspielen von Musik oder das Auffinden von Informationen.
Wie jedoch steht es um das aktive, eigenständige Gestalten von Musik mittels digitaler, webbasierter Tools? Ausgehend von einem globalen Blick auf den Status quo zu dieser Frage wird im vorliegenden Buch die Grundidee eines Komponierens im Social Web mit Schüler(inne)n entwickelt. Die Verschmelzung von Erprobung in der Schulpraxis und wissenschaftlichem Erkenntnisgewinn, orientiert an Ideen der Design-Based Research, zielt darauf ab, das schwierige Verhältnis des Musikunterrichts zum Komponieren bzw. zu digitalen Medien zu erforschen und zugleich ein Stück musikpädagogischer Entwicklungsarbeit zu leisten.
CONTENTS
Vorwort
Einleitung
1. Digitale Medien und Komponieren
1.1 Digitale Medien im Musikunterricht aus nationaler und internationaler Perspektive
1.1.1 Österreich und der deutschsprachige Raum
1.1.1.1 Formale Rahmenbedingungen in Österreich
1.1.1.2 Forschungsstand im deutschsprachigen Raum
1.1.1.3 Entwicklungen von 2006 bis 2014
1.1.2 New Media in the Classroom aus europäischer Sicht
1.1.3 Der internationale englischsprachige Diskurs
1.1.3.1 Fallbeispiel England: Europas Speerspitze in Sachen musikpädagogischer Medienarbeit?
1.1.3.2 Internationale Perspektiven
1.2 Komponieren von Musik im Klassenunterricht
1.2.1 Formale Rahmenbedingungen in Österreich
1.2.2 Der deutschsprachige und internationale musikpädagogische Diskurs
1.2.2.1 Deutschsprachige Publikationen
1.2.2.2 Englischsprachige Publikationen
1.2.3 Relevante Themenfelder zum Komponieren im Klassenzimmer
1.2.3.1 Komponieren in Gruppen
1.2.3.2 Rückmeldung geben: Vom Feedback bis zur formalen Bewertung
1.2.3.3 Spannungsfeld Prozess- versus Produktorientierung
1.2.3.4 Spannungsfeld Eigenständigkeit versus Anleitung
1.2.3.5 „Why and how …“: Prinzipielle Überlegungen zum Komponieren im Unterricht
1.2.3.6 Der Kompositionsbegriff
1.2.3.7 Kreativität
1.2.3.8 Komponieren als Anliegen der Neuen Musik?
1.2.3.9 Weitere Themenfelder
1.3 Technologiebasiertes Komponieren in der Schule
1.3.1 Deutschsprachige und internationale Perspektiven
1.3.2 Forschungsbeispiel: Multimodality als Ansatz zum Verständnis technologiebasierter Kompositionsprozesse
1.3.3 Das Vermont MIDI Project (VTM): Hintergründe und Entwicklung
1.3.4 Vom Vermont MIDI Project zu ecompose Austria
2. Projektstruktur, Methodik und Forschungsintention
2.1 Projekt ecompose Austria: ein Modellversuch im Überblick
2.1.1 Zeitrahmen
2.1.2 Beteiligte Schulklassen und Betreuungspersonen
2.1.3 Grundidee und Konzeptentwicklung
2.1.4 Organisatorische Rahmenbedingungen
2.1.5 Ablauf und Modifikationen
2.2 Forschung in der Praxis – für die Praxis – durch die Praxis
2.2.1 Methodisches Umfeld
2.2.2 Allgemeine Merkmale der Praxisforschungsfamilie
2.2.3 Zur wissenschaftstheoretischen Diskussion in der Musikpädagogik
2.2.4 Zugangsweisen und Forschungsanliegen der vorliegenden Studie
2.3 Vom Schul- zum Entwicklungsforschungsprojekt
2.3.1 Entwicklung als integraler Bestandteil des Forschungsprozesses
2.3.1.1 Design und Entwicklung: Prozessmodelle und Begriffe
2.3.1.2 Entwicklung im Forschungsprozess des ecompose-Projekts
2.3.2 Multiperspektivität
2.3.3 Rollen und Rollenkonflikte im Kontext von Multiperspektivität
2.3.3.1 Beispiel 1: Projektmanager versus Forschungsverantwortlicher – Blick nach vorne oder Blick zurück
2.3.3.2 Beispiel 2: Forschende, Lehrende, Komponisten – die Bedeutung des Faktors Zeit
2.3.3.3 Beispiel 3: Studierende, Hilfslehrende oder Forschungs-Azubis – der Rollenkonflikt der Coaches
2.3.3.4 Conclusio aus den Rollenkonflikten
2.3.4 Methoden der Datenerhebung und Umgang mit dem Aspekt der Datenfülle
2.3.5 Unterschiedliche Perspektiven der zentralen Datenquellen
2.3.6 Vorgehensweise in der Datenauswertung: 4 Schritte der Analyse
2.4 Ziele der Studie
2.4.1 Forschungsfragen
2.4.2 Mögliche Forschungsergebnisse
2.4.3 Grafische Darstellung von Methodik, Vorgangsweise und Zielsetzung
2.5 Die Form der Darstellung
3. OFFLINE & ONLINE: Kommunikation zwischen Klassenzimmer und Internet
3.1 EXKURS: Der Kommunikationsbegriff im Kontext von Medien und Lernen
3.2 Rahmenbedingungen, Einstellungen und Erwartungen im ecompose-Projekt
3.2.1 Rahmenbedingungen
3.2.2 Einstellungen und Erwartungen im Betreuungsteam
3.3 Kommunikation im ecompose-Projekt
3.3.1 Beziehungsebene und Selbstkundgabe in der Kommunikation
3.3.2 Peer-Kommunikation: Beziehungsebene und Interaktion
3.3.3 Online-Kommunikation: Qualität von Postings und Missverständnisse
3.3.4 Stolpersteine in der Online-Kommunikation
3.3.4.1 Initiieren von Online-Kommunikation auf Lernplattformen
3.3.4.2 Entwicklung der Intensität der Kommunikation auf der Lernplattform
3.3.5 Online-Kommunikation zwischen den Schülerinnen und Schülern
3.3.5.1 Formale und informelle Online-Kommunikation
3.3.5.2 Qualität der Online-Kommunikation
3.3.6 Online-Kommunikation zwischen den Betreuenden und den Schülerinnen und Schülern
3.3.6.1 Fachliche Betreuung und persönliche Beziehung
3.3.6.2 Typen der Online-Kommunikation in Moodle
3.3.7 Zusammenhänge zwischen Online- und Offline-Kommunikation
3.4 Motivierung und Identifikation
3.4.1 Motivierung und Selbstwirksamkeitserwartung bei den Schülerinnen und Schülern
3.4.1.1 Klärungsansätze zum Motivationsbegriff
3.4.1.2 Entwicklung von Motivierung und Selbstwirksamkeit im Projektverlauf
3.4.2 Identifikation mit eigenen Kompositionen
3.4.3 Motivierung durch Live-Aufführung
3.4.3.1 Bedeutung der Aufführung von Kompositionen
3.4.3.2 Die Bühne als konkret fassbares Ziel und Ansporn
3.4.3.3 „Mein Stück!“: Emotion, Selbstwert, Stolz und Enttäuschung beim Konzert
3.5 Eigenständigkeit und Anleitung
3.5.1 Musik erfinden im Spannungsfeld zwischen Anleitung und Eigenständigkeit
3.5.1.1 Betreuung zwischen Lehren, Beraten und Begleiten
3.5.1.2 Anleitung oder Experiment als Ausgangspunkt?
3.5.1.3 Unterscheidung zwischen schulischer Aufgabenstellung und Komposition
3.5.1.4 Eigenständigkeit als Illusion?
3.5.2 Lehrer, Komponist, Coach: Das komplexe Zusammenspiel der Rollen und die Einflüsse der Betreuenden
3.5.2.1 Rolle und Einfluss der Lehrer
3.5.2.2 Die Komponisten als Persönlichkeiten und Fachleute
3.5.2.3 Das Zusammenspiel von Lehrer und Komponist
3.5.2.4 Rolle und Einfluss der Coaches
4. KOMPONIEREN: Zugänge zum Erfinden von Musik
4.1 EXKURS: Der Kompositionsbegriff in diesem Buch
4.2 Kreative Prozesse im Schulalltag
4.3 Komponieren im Unterricht aus der ecompose-Perspektive
4.3.1 Vorerfahrungen und Potentiale
4.3.2 Notation und Musiktheorie
4.4 Zugangsweisen zum Erfinden von Musik
4.4.1 Experiment und Konstruktion
4.4.1.1 Vom Experiment zur Konstruktion
4.4.1.2 Von der Konstruktion zum Experiment
4.4.2 Komponieren von individuell bis kollektiv
4.4.2.1 Entwicklung von Teamkonstellationen
4.4.2.2 Fallbeispiel Nina (Perspektive 1) und weitere Fallbeispiele
4.5 Kompositionsprozesse
4.5.1 Prozessmodelle zum Komponieren
4.5.2 Der Entwicklungsaspekt von Kompositionsprozessen
4.5.3 Der Faktor Zeit im Kompositionsprozess
4.5.4 Zusammenhänge zwischen Projektdesign und Kompositionsprozessen
4.5.5 Kompositorische Ergebnisse
4.5.6 „… dadurch, dass das wirklich von mir war …“: Komponieren als Selbstkundgabe
4.5.6.1 Fallbeispiele OÖ
4.5.6.2 Fallbeispiel Nina (Perspektive 2) .
5. SOCIAL WEB: Technologie im musikalischen Kreationsprozess
5.1 EXKURS: Anyone, Anywhere, Anytime – Neue Medien, Social Web und das Lernen
5.1.1 Begriffe: Neue Medien, digitale Medien, Web 2.0, Social Web
5.1.2 Die Mythen des Social Web aus musikpädagogischer Perspektive
5.1.3 E-Learning, Social Web und (musikalisches) Lernen
5.2 Technologie im musikpädagogischen Schulalltag
5.3 Umgang mit Technologie im ecompose-Projekt
5.3.1 Vorerfahrungen der Beteiligten im Umgang mit digitalen Medien und Social Web
5.3.2 Zwischen Medienkompetenz und „Sich-ans-Gerät-Gewöhnen“
5.3.3 Umgang mit der Lernplattform Moodle
5.3.3.1 Das LMS Moodle
5.3.3.2 Moodle im ecompose-Projekt: Usability-Probleme und deren Entwicklung
5.4 Technologie und Komponieren
5.4.1 Das Verhältnis von Technologie und dem eigenständigen Erfinden von Musik
5.4.1.1 Technologie als Potential oder Bedrohung?
5.4.1.2 Technologie als Katalysator: Vernetztheit, Spiel und Experimente ohne Reue
5.4.1.3 Auswirkung musikalischer Vorbildung auf die Technologienutzung
5.4.1.4 Inwieweit beschränkt Technologie die Originalität und Eigenständigkeit beim Komponieren?
5.4.2 Das Online-Notationstool Noteflight
5.4.3 Noteflight als Kompositionswerkzeug
5.4.3.1 Usability
5.4.3.2 Hörbarmachen musikalischer Ideen und Lust am Notieren
5.4.4 Noteflight: Stolpersteine, Grenzen, Wechselwirkungen
5.4.5 Wie wirkt Noteflight? Fallbeispiel Nina (Perspektive 3)
6. Ergebnisse – Entwicklungsprinzipien – Ausblicke
6.1 Entwicklungsprinzipien als Ergebnisse
6.1.1 Online-Notation und Online-Kommunikationsprozesse beim Musik-Erfinden von Schülerinnen und Schülern
6.1.2 Projektdesign und Rollen der Beteiligten
6.1.3 Das Spannungsfeld zwischen Anleitung und Eigenständigkeit im Kontext von Musik- und Kommunikationstechnologien des Social Web
6.1 Entwicklungsprinzipien als Ergebnisse
6.1.1 Online-Notation und Online-Kommunikationsprozesse beim Musik-Erfinden von Schülerinnen und Schülern
6.1.2 Projektdesign und Rollen der Beteiligten
6.1.3 Das Spannungsfeld zwischen Anleitung und Eigenständigkeit im Kontext von Musik- und Kommunikationstechnologien des Social Web
6.1.4 Online-Welt und Live-Erleben im Prozess des Musik-Erfindens
6.1.5 Die Zusammenhänge von Notation, Komponieren und Social-Web-Technologien
6.2 Kritik des Designs
6.2.1 Kritik der praktischen Intervention
6.2.2 Kritik und Grenzen der Forschungsmethode
6.3 Ausblicke und Visionen
6.3.1 Die Zukunft digital vernetzter Technologien im Musikunterricht
6.3.2 Die Zukunft von technologiebasiertem Komponieren im Unterricht
6.3.3 Prognosen zum technologiebasierten Lernen
Zusammenfassung
7. Verzeichnisse und Dokumente
7.1 Verzeichnisse
7.1.1 Literatur
7.1.2 Websites und Blogs
7.1.3 Abbildungen .
7.1.4 Tabellenverzeichnis
7.2 Dokumente und Übersichten
7.2.1 ecompose Austria – Projektbeschreibung (2011)
7.2.2 ecompose Austria − Konzept für die Schulklassen (2010/11)
7.2.3 Tabellarische Übersicht der Datenquellen im ecompose-Projekt
7.2.4 Übersicht über Alter und Vorerfahrungen in den beteiligten Schulklassen
7.2.5 Übersicht über Interviews, Prozessdokumentation und Kodierung
Befragungen
Prozessdokumentation
Gruppengespräche mit Schülerinnen und Schülern aus Projektzyklus 2 (2012)
7.2.6 Interview-Leitfaden für die retrospektiven Gespräche mit Lehrern und Komponisten
7.2.7 ecompose-Projekttagebuch (Vorlage)
7.2.8 Kategoriensystem aus der Kodierung
7.2.9 Häufigkeit der Änderungen von Partituren in Noteflight
7.2.10 Beispiele für Forenpostings auf Moodle




