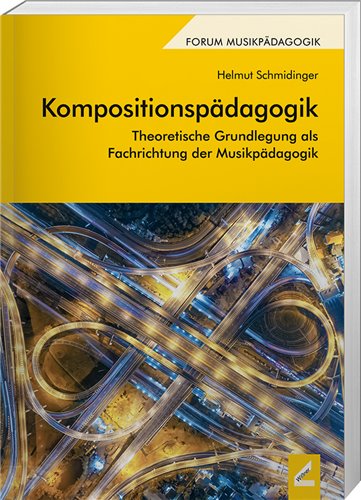
Helmut Schmidinger: Kompositionspädagogik. Theoretische Grundlegung als Fachrichtung der Musikpädagogik, Augsburg: Wißner Musikbuch Verlag, 2020 (Forum Musikpädagogik Band 148, Augsburger Schriften), 310 Seiten, 17 x 24 cm, Deutsch, Abbildungen und Tabellen, Softcover
ISBN 978-3-99094-496-7 (pbk) € 34,80
Kompositionspädagogik
Theoretische Grundlegung als Fachrichtung der Musikpädagogik
Der Begriff der Kompositionspädagogik ist seit dem Jahrtausendwechsel Gegenstand einer zunehmend intensiver werdenden deutschsprachigen Diskussion. Die Auseinandersetzung mit der Themenvielfalt dieser Fachrichtung wird vorrangig in Strukturen vergleichbar jener einer »Community of Practice« geführt. Die Einführung kompositionspädagogischer Ausbildungen an deutschen und österreichischen Musikhochschulen bzw. Universitäten begründete de facto das neue Fach »Kompositionspädagogik«. Damit wurde die Forderung nach der Ausbildung entsprechender, bereits in den Lehrplänen verankerter Kompetenzen zukünftiger Komponist*innen, Musikerzieher*innen sowie Instrumental- und Gesangspädagog*innen erstmals praktisch umgesetzt.
Die Recherche hat aber gezeigt, dass eine theoretische Grundlegung der Kompositionspädagogik als eigenständiges Fach bislang fehlte.
Diesen Beitrag will das vorliegende Buch leisten, ausgehend vom aktuellen Diskurs an den Schnittstellen von Komposition und Musikpädagogik. Dazu werden heutige Praxisfelder im Einzel-, Gruppen- und Klassenunterricht von Schule und Musikschule konturiert, aktuelle Ausbildungsmöglichkeiten analysiert und ein eigenständiges Berufsbild formuliert.
CONTENTS
Vorwort
1. Einleitung
1.1 Relevanz
1.2 Aufbau des Buches
1.3 Forschungsziel und Forschungsfrage
1.4 Forschungsmethode
1.5 Forschungsstand
1.5.1 Historische Kompositionspädagogik
1.5.2 Empirische Kompositionspädagogik
1.5.3 Komparative Kompositionspädagogik
1.5.4 Systematische Kompositionspädagogik
1.5.5 Zusammenfassung
1.6 Begriffsbestimmung Komposition
1.7 Begriffsbestimmung Kompositionspädagogik
1.7.1 Liewald (1998)
1.7.2 Bullerjahn (2003)
1.7.3 Zocher (2007)
1.7.4 Lessing (2011)
1.7.5 Vandré und Lang (2011)
1.7.6 Schlothfeldt (2015)
1.7.7 Wieneke (2016)
1.7.8 Prankl (1992)
1.7.9 Suchy (2013)
1.7.10 Zusammenfassung
2. Berufsfeld
2.1 Historische Skizze
2.1.1 Eingrenzungen
2.1.2 Vom „Liebhaber der Edlen Music“ (Niedt) zur „Komponierwerkstatt für Amateure“ (Henze)
2.2 Aktuelle Situation
2.2.1 Regelschule
2.2.2 Musikschule
2.2.3 Hochschule bzw. Universität
2.2.4 Konzert- bzw. Opernhaus
2.2.5 Öffentlicher Raum
2.2.6 Zusammenfassung
3. Settings
3.1 Kontinuierlicher Einzelunterricht
3.1.1 Portrait „Kompositionsklasse an der Landesmusikschule Thalheim“
3.2 Punktueller Einzelunterricht
3.2.1 Portrait „W.er A.ußer M.ozart?“ – Komponierwerkstatt an der Musikschule Tulln
3.3 Punktuelle Gruppenbildung
3.3.1 Portrait „Komponierwerkstatt für junge KomponistInnen am Arnold Schönberg Center“
3.4 Spontane Gruppenbildung
3.4.1 Portrait „Kanonkomponierwerkstatt“
3.5 Konstante Gruppenbildung
3.5.1 Portrait „Kompositionsklasse für Kinder und Jugendliche an der Kunstuniversität Graz (KUG)“
3.5.2 Portrait „Musikwerkstatt“ – ein Fach an den Landesmusikschulen Leonding und Thalheim
3.6 Altershomogene Klasse
3.6.1 Portrait „Mich wundert überhaupt nichts mehr …!“
3.6.2 Portrait eines ausgewählten KLANGNETZE-Projekts
3.7 Altersheterogene Klasse
3.7.1 Portrait „5 vor 12 – eine humorvolle Revue rund ums Theater“
3.8 Konzertpublikum
3.8.1 Portrait „KYLWIRIA – Ein Mitmachkonzert mit Werken von dir, John Cage und anderen Klangforschern!“
3.9 Vergleich
3.9.1 Vertikaler Vergleich
3.9.2 Horizontaler Vergleich
4. Aufgaben
4.1 Kombinationsaufgabe
4.1.1 Kompositionsbegriff
4.1.2 Charakterisierung des Aufgabentyps
4.1.3 Lernziele
4.1.4 Konkrete Aufgabe
4.1.5 Beispiel aus einer Instrumentalschule
4.1.6 Referenzwerke
4.2 Entwicklungsaufgabe
4.2.1 Kompositionsbegriff
4.2.2 Charakterisierung des Aufgabentyps
4.2.3 Lernziele
4.2.4 Konkrete Aufgabe
4.2.5 Beispiel aus einer Instrumentalschule
4.2.6 Referenzwerke
4.3 Erfindungsaufgabe
4.3.1 Kompositionsbegriff
4.3.2 Charakterisierung des Aufgabentyps
4.3.3 Lernziele
4.3.4 Konkrete Aufgaben
4.3.5 Beispiel aus einer Instrumentalschule
4.3.6 Referenzwerke
4.4 Imaginationsaufgabe
4.4.1 Kompositionsbegriff
4.4.2 Charakterisierung des Aufgabentyps
4.4.3 Lernziele
4.4.4 Konkrete Aufgabe
4.4.5 Beispiel aus einer Instrumentalschule
4.4.6 Referenzwerke
4.5 Rhetorische Aufgabe
4.5.1 Kompositionsbegriff
4.5.2 Charakterisierung des Aufgabentyps
4.5.3 Lernziele
4.5.4 Konkrete Aufgabe
4.5.5 Beispiel aus einer Instrumentalschule
4.5.6 Referenzwerke
4.6 Prozessaufgabe
4.6.1 Kompositionsbegriff
4.6.2 Charakterisierung des Aufgabentyps
4.6.3 Lernziele
4.6.4 Konkrete Aufgabe
4.6.5 Beispiel aus einer Instrumentalschule
4.6.6 Referenzwerke
4.7 Dekompositionsaufgabe
4.7.1 Kompositionsbegriff
4.7.2 Charakterisierung des Aufgabentyps
4.7.3 Lernziele
4.7.4 Konkrete Aufgabe
4.7.5 Beispiel aus einer Instrumentalschule
4.7.6 Referenzwerke
5. Ausbildungen im Hochschulkontext
5.1 Als eigenständiger Studiengang
5.1.1 Grundständig
5.1.2 Konsekutiv
5.1.3 Weiterbildend
5.2 Als Bestandteil von Studiengängen
5.2.1 Grundständig
5.2.2 Konsekutiv
5.2.3 Informell
5.3 Zusammenfassung
5.4 Vergleich der Ausbildung mit der Praxis des Berufsfeldes
6. Berufsbild
6.1 Neues Berufsbild
6.1.1 Vorbildung und Ausbildung
6.1.2 Tätigkeiten
6.1.3 Weiterbildungsformen
6.1.4 Verdienstmöglichkeiten
6.2 Erweiterung bestehender Berufsbilder
7. Zusammenfassung und Ausblick
8. Verzeichnisse
8.1 Literatur
8.2 Abbildungsverzeichnis




