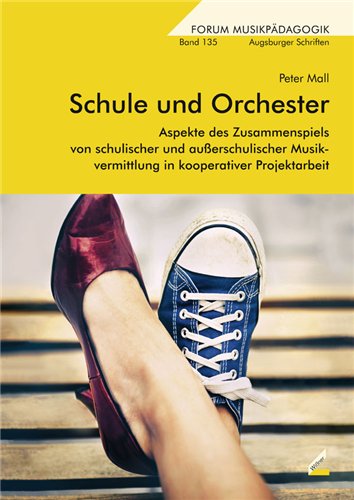
Peter Mall: Schule und Orchester. Aspekte des Zusammenspiels von schulischer und außerschulischer Musikvermittlung in kooperativer Projektarbeit, Augsburg: Wißner Musikbuch Verlag, 2016 (Forum Musikpädagogik Band 135, Augsburger Schriften), 216 Seiten, 17 x 24 cm, Deutsch, Abbildungen, Softcover
ISBN 978-3-99094-460-8 (pbk) € 29,80
Schule und Orchester
Aspekte des Zusammenspiels von schulischer und außerschulischer Musikvermittlung in kooperativer Projektarbeit
Wie kann außerschulische Musikvermittlung und Konzertpädagogik zur musikalischen Entwicklung von Kindern und Jugendlichen beitragen? Kann der Musikunterricht durch außerschulische Angebote bereichert werden, und welche Voraussetzungen sind dafür notwendig, dass Schulen und Orchester kooperieren können? Sind Lehrende und Musiker(innen) schließlich bereit für eine Zusammenarbeit?
Das vorliegende Buch untersucht die Geschichte der Zusammenarbeit von Schulen und Orchestern über die letzten 100 Jahre, entwickelt daraus Argumente für eine engere Kooperation beider Institutionen bzw. für die Integration schulischer und außerschulischer Lernfelder und bietet darüber hinaus Ansätze für deren Umsetzung. In einer mehrdimensionalen empirischen Untersuchung werden die Wirkung von Musikvermittlungsprojekten auf das musikalische Selbstkonzept und die musikalische Lern- und Leistungsmotivation von Lernenden sowie subjektive Theorien zu Gelingensbedingungen kooperativer Projektarbeit von Lehrenden und Musiker(inne)n untersucht.
CONTENTS
Danksagung
Zusammenfassung
Abstract
1. Einleitung
2. Schulische und außerschulische Musikvermittlung
2.1 Musikvermittlung – Hinweise zur Verwendung des Begriffs
2.2 Konzerte für Kinder
2.2.1 Frühe Zeugnisse
2.2.2 1970er-Jahre
2.2.3 1980er-Jahre
2.2.4 1990er-Jahre
2.2.5 Die 2000er-Jahre
2.3 Wissenschaftliche Monographien zur Musikvermittlung
2.3.1 Familienkonzerte in Kooperation mit Grundschulen
2.3.2 Zukunftsmodell Konzertpädagogik
2.3.3 Erlebnisraum Konzert
2.3.4 Musikvermittlung im Kontext
2.4 Projektarbeit mit Kindern
2.4.1 Klangnetze – ein Beispiel für alternative Konzepte
2.4.2 Community Music
2.5 Zusammenfassung
3. Erkenntnistheoretische Grundlagen
3.1 Musikalisches Fähigkeitsselbstkonzept
3.2 Musikalische Lernmotivation
3.3 Kurzinterventionen in der Psychologie
3.4 Musikalisches Zeichen als Grundlage der wissenschaftlichen Musikpädagogik
3.4.1 Der allgemeine Zeichenbegriff
3.4.2 Allgemeines und musikalisches Zeichen
3.4.3 Außerschulische Musikvermittlung als Teil des Zeichenmodells
3.5 Systemtheorie – Luhmann
3.6 Dokumentarische Methode
3.7 Individualkonzepte
4. Forschungsansatz
4.1 Stand der Forschung
4.2 Forschungsfragen
5. Durchführung der Studie – Methoden
5.1 Projekte der Kooperation
5.1.1 Kinder- und Jugendkonzerte
5.1.2 TamTam
5.1.3 Musik macht Schule
5.1.4 Eröffnungsveranstaltung
5.1.5 Patenschaften der Musiker(innen)
5.1.6 Till Eulenspiegel-Konzert
5.1.7 Klangvisionen
5.1.8 Romeo ft. Julia
5.1.9 Abschlussprojekt mit dem Komponisten M. T.
5.1.10 Zusammenfassung
5.2 Erhebungsinstrumente – Methode – Studiendesign
5.2.1 Quantitative Studie: Einfluss von Musikvermittlungsprojekten auf das
musikalische Selbstkonzept sowie die musikalische Lern- und Leistungsmotivation
von Schüler(inne)n
5.2.2 Qualitative Studie – Individualkonzepte Lehrkräfte und Musiker(innen)
6. Ergebnisse
6.1 Wirkung von Musikvermittlungsangeboten auf musikalisches Selbstkonzept,
musikalische Lern- und Leistungsmotivation von Schüler(inne)n
6.1.1 Pre-Test
6.1.2 Pre-Post-Vergleich
6.2 Auswertung der Schülerantworten auf dem Fragebogen der Post-Befragung
6.2.1 Rangfolge der Angebote
6.2.2 Qualitative Auswertung der Erklärungen der Schüler(innen)
6.2.3 Zusammenfassung
6.3 Fallzusammenfassungen
6.3.1 Lehrkräfte
6.3.2 Musiker(innen)
6.4 Entwicklung der Typologien
6.4.1 Typenbildung mit der dokumentarischen Methode – Analyse der
unterschiedlichen Darstellung eines TamTam-Besuchs dreier Lehrkräfte
6.4.2 Weitere Vergleichselemente
6.4.3 Typenbildung
6.5 Typologie der Lehrkräfte
6.5.1 Typ 1 – „Endlich wieder mehr Musik“: Lehrkraft ohne musikpädagogische Ausbildung mit Neigung zur Musik
6.5.2 Typ 2 – „Ich brauche jemanden, der das alleine machen kann“: Lehrkräfte ohne musikalische Ausbildung
6.5.3 Typ 3 – „Vieles bekomme ich alleine besser hin“: Fachlehrkraft Musik
6.5.4 Zusammenfassung
6.6 Typologie der Musiker(innen)
6.6.1 Typ 1 – die pädagogisch Interessierten
6.6.2 Typ 2 – die Unsicheren
6.6.3 Typ 3 – die Wertenden
6.6.4 Zusammenfassung
7. Diskussion
7.1 Einschränkungen
7.2 Schüler(innen) (quantitative Studie)
7.3 Lehrkräfte und Musiker(innen)
7.4 Drei Thesen zur Musikvermittlung
7.5 Schlusswort
8. Anhang
8.1 Tabellenverzeichnis
8.2 Abbildungsverzeichnis
8.3 Literaturverzeichnis
8.4 Fragebögen, Leitfäden
8.4.1 Leitfaden Lehrkräfte
8.4.2 Leitfaden Musiker(innen)




