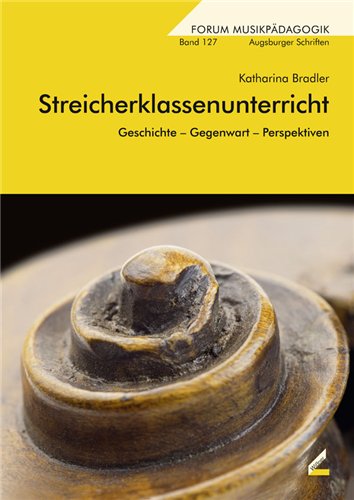
Katharina Bradler: Streicherklassenunterricht. Geschichte – Gegenwart – Perspektiven, Augsburg: Wißner Musikbuch Verlag, 2014 (Forum Musikpädagogik Band 127, Augsburger Schriften), 292 Seiten, 17 x 24 cm, Deutsch, Abbildungen, Softcover
ISBN 978-3-99094-422-6 (pbk) € 34,80
Streicherklassenunterricht
Geschichte – Gegenwart – Perspektiven
Streicherklassenunterricht ist heute eine weit verbreitete Unterrichtsform, bei der Schülerinnen und Schüler eines der Instrumente Violine, Viola, Violoncello oder Kontrabass gemeinsam im Klassenverband erlernen. Da sich der Unterricht in Deutschland aus der Praxis heraus entwickelte und im Rahmen eines „Klassenmusizierbooms“ trendartig ausbreitete, herrschen heute vielfältige Ansichten über die Unterrichtsform. Bislang wurde Streicherklassenunterricht weder historisch noch systematisch untersucht. Dieser Aufgabe widmet sich Katharina Bradler mit diesem Buch.
In einem geschichtlichen Teil zeichnet sie die Entwicklung der Unterrichtsform von den Anfängen bis in die Gegenwart nach. Dabei werden fehlerhafte Überlieferungen aufgedeckt und wichtige Unterrichtsprinzipien dargestellt. Der zweite Teil richtet den Blick auf die Gegenwart in Deutschland und trägt vielfältige Informationen zusammen: Wichtige Begriffe werden geklärt, ausgewählte Modelle führen Möglichkeiten der praktischen Umsetzung vor Augen, Lehrwerke verdeutlichen Herangehensweisen im Unterricht. Auf der Grundlage der gewonnenen Erkenntnisse erschließt die Autorin didaktische Prinzipien. Im dritten Teil weisen Perspektiven auf mögliche Probleme und Chancen der Unterrichtsform hin. Dies soll zur Qualitätssicherung und zur konzeptionellen Weiterentwicklung von Unterricht mit Streicherklassen beitragen.
CONTENTS
Abkürzungen
Vorwort
Einleitung
1. Thema und Relevanz
2. Ziel
3. Vorgehen
4. Quellenlage
Glossar
I. Geschichte
1. Violinklassen in England: Das Maidstone Movement
2. Violin- und Streicherklassen in den USA
2.1 Albert Mitchells Adaption des Maidstone Movement 1911
2.2 Unterrichtsformen vor 1911: Private Violinklassen
2.3 Entwicklungen nach 1911: Instrumentalklassen an öffentlichen Schulen
2.3.1 Die Anfänge
2.3.2 Entwicklung von den 1920er bis zu den 1950er Jahren
2.3.3 Situation in den 1950er Jahren
2.4 Paul Rolland
2.4.1 Der frühe Rolland: Begegnung mit Streicherklassenunterricht vor 1960
2.4.2 Der späte Rolland: Das Illinois String Research Project
2.4.3 Ergebnisse des Illinois String Research Project: Die Rolland-Methode
2.4.4 Die Zeit nach dem Illinois String Research Project
3. Entwicklung in Deutschland
3.1 Instrumentalunterricht und schulischer Musikunterricht vor 1991
3.1.1 Vom 15. Jahrhundert bis ins 19. Jahrhundert
3.1.2 Von den 1920er Jahren bis 1945
3.1.3 Tendenzen nach 1945
3.1.4 Klassenmusizieren von den 1970er Jahren bis in die 1990er Jahre
3.2 Die ersten Streicherklassen in Deutschland
3.2.1 Ursprünge
3.2.2 „Streicherklassen-Unterricht nach Paul Rolland“ – Das Pilotprojekt der Akademie für Musikpädagogik (1991–1994)
3.3 Entwicklung des Streicherklassenunterrichts von den 1990er Jahren bis in die Gegenwart
3.3.1 Hintergrund: Wachsende Popularität des Klassenmusizierens
3.3.2 Weiterentwicklung des Streicherklassenunterrichts
3.3.3 Tradierung der Rolland-Methode
3.3.4 Tendenzen nach der Jahrtausendwende
4. Die Entwicklung in den USA und in Deutschland:
Ein Vergleich mit Blick auf die Gegenwart
4.1 Die Vorläufer
4.2 Die ersten Klassen
4.3 Die weitere Entwicklung
4.4 Die Unterrichtsform in Abhängigkeit von finanziellen Aspekten
4.5 Die Gründe für die Einrichtung von Streicherklassen
4.6 Zur Methodik und Didaktik
4.6.1 Assistenzarbeit im Team-Teaching
4.6.2 Klavier als methodisches Hilfsmittel
4.6.3 Weitere Prinzipien
4.6.4 Organisation und Rahmenbedingungen
II. Gegenwart
1. Ausgangslage
1.1 Positive Entwicklungen
1.2 Negative Entwicklungen
2. Begriffsklärungen
2.1 Klassenmusizieren
2.1.1 Freies Klassenmusizieren
2.1.2 Klasseninstrumentalunterricht (Klassenvokalunterricht)
2.2 Streicherklasse
3. Ausgewählte Modelle aus der Praxis
3.1 Streicherklassen an Primarschulen
3.1.1 Vier-Jahres-Modell: Grundschule Buchholz
3.1.2 ‚Kooperationsquadrat‘: Staatliche Gemeinschaftsschule Weimar
3.1.3 Musikunterricht als Instrumentalunterricht: Freie Grundschule Wernigerode
3.2 Streicherklassen an Sekundarschulen
3.2.1 Drei-Jahres-Modell: Gymnasium St. Michael in Ahlen
3.2.2 Musikzweig: Ratsgymnasium Rotenburg an der Wümme
3.2.3 Wahlpflichtunterricht: Sophie-Scholl-Schule Berlin
3.3 Vergleich der Modelle
3.3.1 Übereinstimmungen
3.3.2 Differenzen
3.4 Weiterführende Fragen
3.4.1 Fortsetzung des Unterrichts
3.4.2 Finanzierung
4. Deutschsprachige Unterrichtswerke
4.1 Vier auf einen Streich (Steinkühler 2005)
4.2 Klassenmusizieren (Rundfeldt 2006)
4.3 Vier beginnt (Braun/Kummer/Seiling 2008)
4.4 Streicher-Kleeblatt (Drebenstedt 2010a)
4.5 Die Schneckenklasse (Wanner-Herren/Fisch 2012/13)
4.6 Streicher sind klasse (Boch 2008)
4.7 Schlussfolgerungen
4.7.1 Anlehnung an das ‚didaktische Gesamtpaket‘
4.7.2 Modifizierungen gegenüber dem ‚didaktischen Gesamtpaket‘
4.7.3 Aufbau als Instrumentalschule
4.7.4 Weiterführende Fragen
5. Didaktische Prinzipien von Streicherklassenunterricht
5.1 Didaktische Grundprinzipien
5.1.1 Handlungsorientierter und aufbauender Unterricht
5.1.2 Differenzierender Unterricht
5.2 Rahmenbedingungen von Streicherklassenunterricht
5.2.1 Bedingung 1: Der Unterricht findet mehrmals wöchentlich statt
5.2.2 Bedingung 2: Der Unterricht wird von einem Lehrerteam gehalten
5.2.3 Bedingung 3: Organisatorische Aspekte sind hinreichend geplant und geklärt
5.2.4 Bedingung 4: Der Unterricht ist Anfängerunterricht
5.3 Ziele, Inhalte und Methoden von Streicherklassenunterricht
5.3.1 Ziele und Inhalte
5.3.2 Methoden
6. Einzel- und Gruppenunterricht im Vergleich
6.1 Vorüberlegungen
6.2 Vergleich
III. Perspektiven
1. Zur Diskussion um Einzel- versus Gruppen- bzw. Klassenunterricht
2. Äußere Begründungen: Von Kommerzialisierung, Sparzwängen und Transfereffekten
3. Boom, ‚Projektitis‘ und die Wichtigkeit von Qualität und Nachhaltigkeit im Streicherklassenunterricht
4. Gedanken zur Tradierung der Rolland-Methode
5. Befruchtende Kooperationen: Perspektiven gemeinsamer Wege
6. Didaktische Weiterentwicklung von Streicherklassenunterricht
Verzeichnisse
1. Literaturverzeichnis
2. Abbildungsverzeichnis
Anhang
1. Fragebogen zu Modellen des Streicherklassenunterrichts
2. Verzeichnisse aus The Teaching of Action in String Playing
2.1 Verkürzte Version des Deckblatts und Inhaltsverzeichnisses von
The Teaching of Action in String Playing (Rolland 1974)
2.2 Ausschnitte aus dem „Suggested Curriculum Guide“ von
The Teaching of Action in String Playing (Rolland 2000)
3. Phasen des Illinois String Research Project
4. Aussagen von Paul Rolland zum Verhältnis von Einzel- und Gruppenunterricht
5. Arbeitshilfen des VdM: Zu Kooperationen von Musikschule und
allgemein bildender Schule (VdM 2005)
6. Leitgedanken zum instrumentalen und vokalen Gruppenunterricht (VdM 1995)

